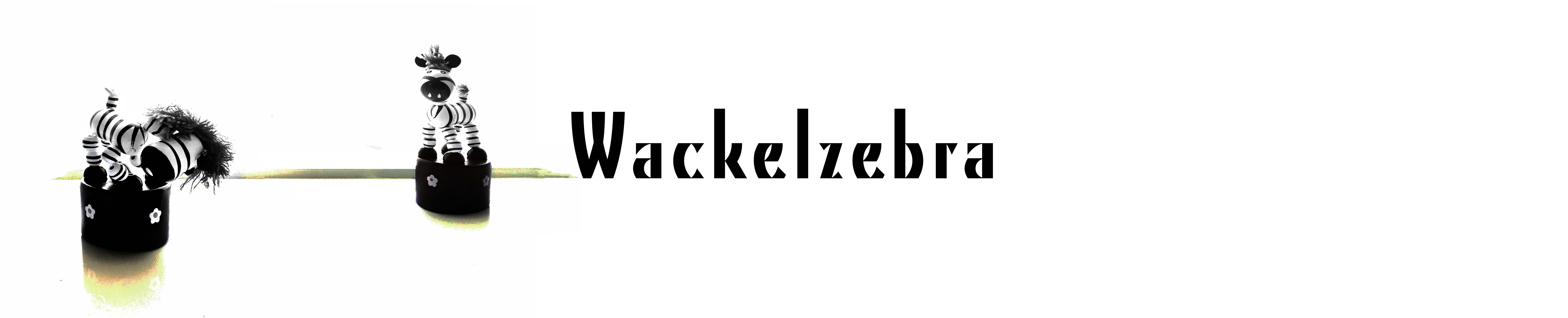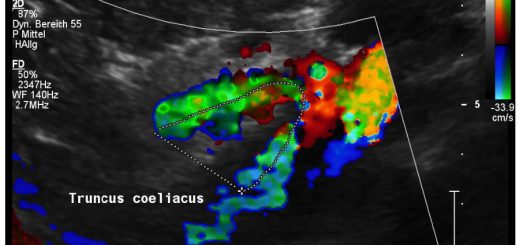Ich, von innen gesehen: Das etwas andere Geburtstags-Shooting
Zugegeben, man kann seinen Einundfünfzigsten auch schöner verbringen. Doch wenn’s terminlich nicht anders geht, wackelt frau auch mal einen Jahrestag lang in der Gefäßchirurgie herum. Holt eine Zweitmeinung zu den Gefäßkompressionen ein. Und vier Geschenke ab: ein Treffen mit wunderbaren Freunden und „Klinik-Chauffeuren“; einen Arzt von positivem Seltenheitswert; spektakuläre Petra-Innenaufnahmen; und eine diskutable Diagnose.
Kati und Martin holen mich morgens ab. Sie sind gut gelaunt, als wir in die exakt 100 Kilometer entfernte Klinik fahren. Mulmig ist mir dennoch vor dem Termin beim Gefäßchirurgen. Zum einen wegen der doch besorgniserregenden Erstmeinung „hochgradig abgequetschte Bauchaorta und Nierenvene sowie Blutstau im Becken“ – samt Empfehlung zu einer hochriskanten OP. Zum andern, weil mich die letzten Monate mit zu vielen Medizinern konfrontiert haben, die trotz gesichertem Gendefekt den „EDS kenn ich nicht, das ist doch alles psychisch“-Stempel aus ihrem weißbekittelten Ärmel zogen. Kompetenz und Menschlichkeit? Oder gar die Bereitschaft, sich ein paar Minuten bei Tante Google in das seltene Krankheitsbild einzulesen? Fehlanzeige. Ein großes und sehr trauriges Thema unter uns „Zebras“.
Freundlich in der Klinik: Empfangsfrau bis Chefarzt
Doch schon als wir dir Klinik betreten, sind alle Bedenken dahin. Die Dame an der Anmeldung: nett und hilfsbereit. Die Assistentin, die mich zum Wartebereich begleitet: charmant und offen. Der Chefarzt der Gefäßchirurgie: auf Anhieb sympathisch. Etwa mein Alter, rund, Dreitagebart, mit lachenden Augen und einem festen Händedruck empfängt er mich. Und noch bevor er mir einen Platz anbietet, ist mir klar: Das passt. Er erinnert sich bestens an unseren Vorab-Mailkontakt. Weiß, dass ich Krimiautorin und mit EDS und erheblichen Gefäßkompressionen diagnostiziert bin. Er kennt dieses Blog und kommentiert das Wackelzebra mit: „Das finde ich richtig gut.“ Wir sind sofort im Gespräch. Auf Augenhöhe. Und mit Zeit.
Zusammen sichten wir vor einem großen Monitor die Bilder der MR-Angiographie, die eine niedergelassene Radiologie vor fünf Tagen von meinem Bauchraum angefertigt hat. Sie sollte als arterielle Darstellung die Truncus-coeliacus-Kompression (Dunbar-Syndrom) überprüfen. Und möglicherweise die Stenose der linken Nierenvene (Nussknacker-Syndrom) bestätigen oder widerlegen.
Der Gefäßchirurg setzt eine schmale rote Brille auf. Klickt sich durch die Aufnahmen. Hebt die Augenbrauen. „Sehen Sie das?“ Ich bejahe. Grau in Grau mit überstrahlten weißen Flecken. Ein verwaschener Truncus-coeliacus-Abgang. Ist da eine Kompression zu sehen? Oder doch eher keine? Der Arzt blättert weiter. Brummt vor sich hin. Dann erscheint wie im Nebel die linke Nierenvene. Der Chirurg wendet sich zu mir und sieht mich über die Brille hinweg an. „Jetzt machen wir erst einmal anständige Fotos.“
Vergesslich im Röntgenröhren-Karussell: Histamin und Cortison
Einen langen Flur, zwei Türen und zwanzig Minuten später liegt der Venenzugang fürs Kontrastmittel. Gemacht wird eine Dünnschicht-3D-CT-Angiographie. Auch hier in der Radiologie sind die Ärzte aufmerksam und die Helferinnen zugewandt. Letztere lagern mich vorsichtig auf dem Tisch, der mich gleich darauf in das „Karussell“ aus Röntgenröhren fährt. In Ein-Millimeter-Schichten fertigt der Computertomograph Datensätze meines Körpers an. Vom Rachen bis zum Becken.

Computertomograph (CT) nach dem Erstellen meiner Dünnschicht-CT-Angiographie. Foto/Copyright: Petra Busch
Meine instabile Halswirbelsäule und die andern Wackelgelenke liegen sicher. Keine Selbstverständlichkeit. Ich bin also entspannt und folge den üblichen Atemkommandos, die mich übers Mikro erreichen. „Einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen“ – und während ich die Luft anhalte, fällt mir plötzlich ein, dass ich vergessen habe, mir einen Histaminhemmer und Cortison spritzen zu lassen. Zu spät: Schon wird mit heiß, schwindelig, ich habe das typische Gefühl, mich einzunässen, im Mund breitet sich der Geschmack nach Alleskleber aus. Das Kontrastmittel schwappt durch meine Gefäße. Mit ihm eine satte Portion Jod. Und ich weiß: Die nächsten Tage werde ich mit Jammern, Bauchkrämpfen und 50 Rollen Toilettenpapier verbringen. Jod triggert bei mir alles, was frau nicht braucht. Sofort schalte ich auf unentspannt. „Weiteratmen“, sagt die Mikrofonstimme.
Nebensächlich im Radiologenraum: gedoppelte Arterien, SD-Knoten, Myom
Die ersten Bilder zeigt mir der Radiologe. Sie sind schwarzweiß, so, wie ich CT-Bilder kenne. Sie enthüllen auf den ersten Blick keine dramatischen Gefäßkompressionen. Aber gleich ein paar Nebenbefunde: Meine Nieren besitzen beide eine zusätzliche, also gedoppelte Arterie. Solche stenosieren ganz gern. Aktuell scheint aber alles okay. Dann sind da zwei Knoten in der Schilddrüse, ein heißer und ein kalter. Das weiß ich aber schon. Auch, dass ich die endlich endokrinologisch abklären lassen muss. Ein großes Uterusmyom sitzt da auch noch. Also zur Gynäkologin. Die Vorsorge ist ohnehin fällig.
Diskutabel im Chefarztzimmer: Gefäßkompressionen und OPs
Zurück beim Gefäßchirurgen, sitzen wir erneut vor dem großen Monitor. Als die CT-Bilder auftauchen, frage ich überrascht: „Bin ich das?“ Der Chefarzt lacht verschmitzt. „Ja. In 3D-Aufbereitung. Aber das wird noch besser. Erst mal müssen wir Ihren den Kopf ab- und die Rippen herausschneiden und Sie dann drehn.“

Bearbeiten der CTA-Aufnahmen zwecks Freistellen des Truncus coeliacus: keine relevante Kompression zu sehen. Foto/Copyright: Petra Busch
Ein paar Mausklicks, grüne Markierungslinien, Löschbefehle – und das gestochen scharfe Gefäßgeflecht leuchtet plastisch und rotgelb vor schwarzem Hintergrund. Ohne Rippen, ohne störende Strukturen. Beim Drehen lässt mein Inneres sich von allen Seiten, von oben nach unten und umgekehrt anschauen.
Der Gefäßchirurg zoomt einen Ausschnitt heran. „Hier ist Ihr Truncus-Abgang. Sehr dicht daneben der Abgang der Arteria mesenterica superior.“ Er deutet auf ein dickes Gefäß, aus dem schräg übereinander zwei dünnere herausführen. „Ich kann keine relevante Truncus-Kompression erkennen.“ Ich schaue ihn an. „Echt nicht?“ „Nein, echt nicht.“ Er lächelt. „Da sind keine strukturellen Einschnürungen.“
Er vergrößert einen zweiten Bildausschnitt. Der Mauszeiger bewegt sich auf dem Monitor. „Hier sehen Sie Ihre linke Nierenvene. Schmal, ja. Aber er Raum zwischen der Arteria mesenterica superior und der Aorta ist nicht auffallend eng.“ Ich schaue auf das Bild. Dann zu ihm. Er fährt fort. „Ich sehe auch keine größeren Venenkonglomerationen im Beckenbereich.“ „Also kein extremes Nussknacker-Syndrom und kein Pelvines Kongestionssyndrom?“, frage ich voller Hoffnung. „Nein“. Er schüttelt den Kopf. Ich denke an den Altbau in Leipzig. Ende Juni:
Ich auf der Untersuchungsliege, über mir der Monitor mit den bunten Bildern des Farbdoppler-Ultraschalls. Da sind der blau, grellgrün und rot flimmernden Haken und die Stimme des Professors „Da hab ich ihn, den schön abgequetschter Truncus coeliacus“. Da bewegen sich blaue und rote Gebilde und es heißt „ausgeprägt stenosierte Nierenvene“ und „Blutstau im Becken“. Übelkeit. Angst.
Ich verdränge die Erinnerung. Doch was nun? Zwei Ärzte, drei Meinungen?
Ich frage den Gefäßchirurgen. Wir reden lange. Über Diagnostik, Interpretation von Bildern und darüber, dass man keine Befunde, sondern Menschen operiert – und bei mir glücklicherweise die ausgeprägten klinischen Symptome fehlen, die eine so große OP rechtfertigen. Wir sprechen über die Risiken einer Dunbar- und Nussknacker-OP, erst recht für Ehlers-Danlos-Patienten. Über die Vorteile einer offenen gegenüber einer laparoskopischen Operation – denn damit hatte ich mich nach der Erstdiagnose schon prophylaktisch befasst.
Theoretisch im OP: offene vs. minimalinvasive Dunbar-OP und Nussknacker-Stent
Eine offene OP – nur die praktiziert der Chefarzt der Gefäßchirurgie beim Dunbar-Syndrom – hat den Vorteil, dass umliegendes Gewebe viel sauberer durchtrennt oder entfernt werden kann, um den eingequetschten Truncus zu „befreien“. Sie senkt das Risiko einer ungewollten Gefäß- oder Gewebeverletzung. Und reduziert die Rezidivhäufigkeit.
Nierenstenosen können unter lokaler Anästhesiemit einem Stent versorgt werden. Nicht aber bei EDS-Patienten. Denn bei dem wirken lokale Betäubungen meist nicht oder nur schlecht. Aber selbst unter Vollnarkose eingesetzt, würde ein Stent aufgrund des labberigen Gewebes wohl auch nicht halten. Auch ein Verlegen der Schlagvene oder eine Autotransplantation der Niere würde bei fehlerhaft strukturiertem Bindegewebe in die OP-Hosen gehen.
Aber gut, was wäre wenn … Die hochriskante(n) OP(s) hake ich nun erst einmal ab. Und bin erleichtert.
Wir reden weiter. Weil mich so vieles interessiert. Stents. Aus was sie gemacht sind und wie der Arzt sie bei welchen Gefäßen implantiert. Der Gefäßchirurg zeigt mir dazu einen Film und besondere CTA-Bilder. Ich will wissen, wie der Alltag zwischen Gefäßambulanz, langen Fluren und OP aussieht. Er erzählt von den täglichen OPs. Dass er sich freut, wenn ein besonders schwerer Eingriff ein Leben rettet. Und es ihn berührt, wenn er trotz aller Bemühungen nicht mehr helfen kann. Und während er redet, spuken in meinem Kopf spuken neue Krimiideen herum. Seltsame Mordmethoden. Als könne er mit CT-Augen meine Gedanken entschlüsseln, hebt er die Mundwinkel. „Komme ich jetzt in einem Ihrer nächsten Bücher vor?“ „Jedenfalls nicht als Opfer“, versichere ich ihm, und wir fangen an zu lachen.
Nachdenklich in der Cafeteria: Schmerzen, Erschöpfung, Dankbarkeit
Ich gehe hinaus, durch den Flur, in die Halle und von dort in die Caféteria. Nur die Frau hinter der Theke ist noch da. Mit Birnenkuchen und Cappuccino setze ich mich auf einen Barhocker. Warte auf Kati und Martin und lasse die Gedanken Revue passieren. Wie immer nagen die Schmerzen an mir und ich bin bleiern erschöpft – aber auch dankbar. Für einen Arzt, der das Ehlers-Danlos-Syndrom kennt, Humor, viel Fachwissen und Zeit für mich hatte. Der meine Angst genommen und mich mit den Worten verabschiedet hat: „Jetzt verarbeiten Sie Ihren Besuch bei mir mal im Wackelzebra-Blog, und dann sehen wir uns in einem Jahr zur Kontrolle wieder.“
Auftrag Teil eins ausgeführt 🙂
—–
Nachklapp:
- Der Geburtstagsabend war noch großartig. Spontanes Flammkuchenessen mit Kati, Martin und anderen lieben Freunden.
- Die Tage nach der Kontrastmittelgabe haben sich wie befürchtet magen-darm-technisch als eher … ähm … unerfreulich entpuppt. Ebenso …
- … der Termin in der HNO-Klinik am Tag nach meinem Geburtstag.
- Das Myom im Uterus hat meine Gynäkologin abgeklärt. Vorerst kein Grund zur Sorge.
- Meine Endokrinologin hat erst nächstes Jahr im April Termine frei. Und seien die Schilddrüsenknoten noch so groß und heiß und kalt. Na toll.