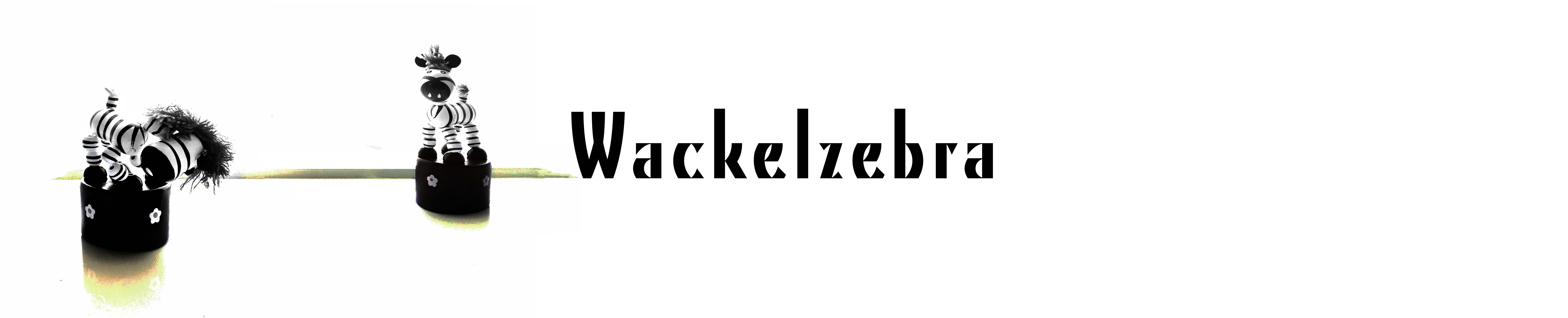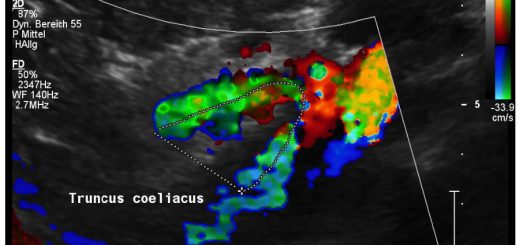Es sind diese Tage … Vom Aufgeben.
Schon seit Tagen will ich bloggen. Schaffe es aber kaum noch. Ich bin am Ende. Weiß nicht, wie die Krankheit(en) noch ertragen. Unendliche Schmerzen, Instabilität von den Zehen bis in die Kopfgelenke, vegetative und neurologische Ausfälle, Essen, das im Hals stecken bleibt, abgequetschte Gefäße, immer mehr Unverträglichkeiten, Blasenschwäche, Zwerchfellbruch, Polyneuropathien, CMD, Verlust des Richtungshörens, Tinnitus und zunehmende Luftnot aufgrund des lockeren Kehlkopfs. Es sind die Tage, an denen das Leben sich zurückzieht. An denen es grau wird und dunkel. Die Tage, an denen ich aufgebe.
Vergangene Woche war wieder Klinik angesagt. Diagnostik des Kopf-Hals-Bereichs. Weil ich kaum noch atmen kann und das Essen nicht mehr schlucken. Weil der Brustkorb so grauenhaft schmerzt.
Ausgemacht war der Termin seit zehn Tagen. Dienstag um 10 Uhr sollte ich da sein. Mit gepacktem Koffer wackle ich um zwanzig vor zehn durch die Drehtür in den ausladenden Klinikgang. LWS- und Köchelbandagen halten mich etwas. Ich japse und hoffe, meine Schulter hält ohne Subluxation dem Gewicht des Koffers stand, der laut klappernd hinter mir herrollt. Ich bleibe stehe, ringe nach Luft. Der Hals schmerzt schrecklich, und irgendwas im Kehlkopf verschiebt sich immer so, dass es schrecklich knackt und knirscht und mir die Luft zum Atmen nimmt.
An der Info sagt die blondgelockte Dame mir, ich solle eine Wartenummer ziehen. „Da drüben, an dem silbernen Kästchen.“ Sie deutet nach rechts. „Und dann gehen sie zu den Leuten da.“ Ich blicke in die Wartehalle. 30 Menschen, schätze ich. Schulter an Schulter. Einige tippen auf ihren Handys herum, andere starren vor sich hin, eine Frau weint.
Ich ziehe die 44. Setze mich mit dem Zettelchen in der Hand ein Stück abseits und beobachte die Gestalten, die hin und herlaufen. Ich mag keine Menschenansammlungen. Immer weniger. Und ich sitze ungern so eng zwischen vielen Fremden. Erst recht nicht, wenn es mir so mies geht.Nach eineinhalb Stunden blinkt auf einem Monitor die 44. In Raum 3 soll ich kommen. Dort begrüßt mich eine ernste, dicke Dame, und ich reiche ihr meine Einweisung und das Versicherungskärtchen. Stumm tippt sie auf ihrer Rechnertastatur, schaut dann auf und telefoniert. „Ah, mhm, okay“, höre ich, und die Dame wendet den Blick von mir ab. „Das ist ja doof. Hm, gut. Ich schick sie hoch.“ Sie sieht mich wieder an. „Sie sollen direkt in den dritten Stock kommen, da ist auch einen Aufnahme.“ Na toll. Dafür warte ich jetzt so lang? Und jetzt womöglich dasselbe Spiel?
Ich fahre in den dritten Stock, im Aufzug stehen alle mit dem Rücken zur Wand und blicken zu Boden. Mir recht. Oben angekommen, sehe ich schon das Schild „Aufnahme“ – und etwa zehn Wartende. Ich setze mich, bis eine Helferin herauskommt. „Frau Busch?“, ruft sie.
Ich gehe hinein. Sie lächelt, reicht mir die Hand. „Setzen Sie sich.“
Ich stelle den Koffer ab, lege meine Tasche darauf und sinke ihr gegenüber auf einen braun gepolsterten Stuhl. Die Luftnot ist eine Qual, und mir wird wieder schwarz vor Augen.
Der Raum ist klein, voller Ordner, zwei Schreibtische. Ein paar Taschen und zwei weitere Koffer stehen herum.
Die Frau sieht mich an. Ihr Lächeln ist verschwunden. „Es tut mir leid, aber das Haus ist voll. Sie müssen wieder gehen.“
Ich starre sie an, sacke in mir zusammen. Mir laufen die Tränen runter, ich kann es nicht verhindern. Aber ich schäme mich schon lang nicht mehr. „Was? Aber ich habe einen Termin. Seit zehn Tagen ausgemacht.“
„Es tut mir leid, Sie können ja nächste Woche wieder kommen.“
Jetzt fange ich richtig an zu heulen, und die Luftnot gibt mir den Rest. „Ich gehe nicht weg“, presse ich mühsam hervor.
„Ihnen geht es wirklich schlecht, das sehe ich.“
„Ich kriege kaum noch Luft. Ich kann nichts mehr essen. Ich habe tagelang geplant, damit meine Tiere in den nächsten Tagen versorgt sind.“
„Nehmen Sie mal draußen Platz.“
Mühsam stehe ich auf. Ich bin so schwach, dass ich die paar Schritte kaum schaffe. Die Waden krampfen und zittern die Polyneuropathien in den Füßen lassen mich beinahe aufschreien. Vor Tränen erkenne ich nichts, setze mich einfach irgendwohin. Höre, wie die Frau – die die Tür offengelassen hat –, telefoniert und dem Arzt, der mich betreuen soll, erklärt, dass ich unmöglich wieder weggeschickt werden könne in meinem Zustand.
Dann bin ich wie weggetreten. Lasse alles wie im Nebel über mich ergehen und achte auf nichts mehr, nur darauf, nicht umzufallen.
Eine Stunde später finde ich mich in einem Dreibettzimmer wieder. Ich wurde über die Zentrale Notaufnahmen aufgenommen – ein Umweg, der mit Einweisung nicht hätte sein sollen – und in der Station für „Kurzlieger“ provisorisch untergebracht. Rechts und links von mir Frauen, die stumm im Bett liegen, kein Bad, keine Toilette. Ich liege also da, bin unendlich erschöpft, kann kaum noch die Augen offen halten. Die Genzkörperschmerzen und das Stechen und Kribbeln in den Füßen bringen mich fast um, die Atemnot sowieso. Die Frau rechts spricht mich an und erzählt, dass sie vier Katzen hat. Gutes Thema, es lenkt ab. „Ich habe fünf“, sage ich. „Bis vor zwei Wochen waren es noch sieben. Zwei sind gerade ausgezogen, weil ich die Versorgung nicht mehr schaffe.“ Schon als ich es erzähle, muss ich wieder weinen.
Dass ich meine geliebten Katzen abgeben muss – auch die fünf, die aktuell noch bei mir sind –, ist der schlimmste Alptraum, den ich mir je hätte vorstellen können. Ich liebe diese Tiere über alles. Jedes mit seinen speziellen Krankheiten und Bedürfnissen, wegen der sie bei mir ja hängengeblieben sind in der Zeit, als ich noch aktiv und Katzenpflegestelle war, in der ich viel Katzenschutz machen konnte. Ich hatte jedem meiner Fellkinder in die Pfote versprochen, immer für es dazu sein. Es zu beschützen und zu behüten du zu versorgen – bis zu sesinem letzten Atemzug. Egal, was passiert. Ich habe mit allem gerechnet. Langen, schweren Krebserkrankungen der Katzen, Nierenversagen, Blindheit, Pankreatitis … Alles, woran Katzen häufig leiden oder sterben. Nur nicht damit, dass ich vor ihnen gehen muss. Und nun Menschen brauche, die sie mit viel Liebe weiter versorgen, bis sie einmal nicht mehr können.
Das ist schwer. So schwer, wenn die Katzen nicht mehr jung und chronisch krank sind. Wer wird sich kümmern, sie lieben und kraulen, den Bürstenkönig Grisù ausgiebig bürsten und seine Anämie im Auge behalten? Wer wird mit den Asthmatigern Krabat und Pauline inhalieren, auch wenn Pauline lieber auf der Heizung brät als Medikamente zu nehmen? Wer wird Krabats Schmuseattacken im Bett und auf dem Tisch dulden? Ihm, der zwei Baustelen hat, und Fuchur Augensalbe geben, falls das Herpes wieder ausbricht? Wer wird Fuchur auf die linke Schulter legen, wenn er Angst hat und zum Beruhigen unbedingt am Frottee-Zopfgummi nuckeln muss? Zu wem darf Momo unter die Decke kriechen, andocken und dauerschnurren?
Ich darf nicht nachdenken. Sonst werde ich verrückt. Meine zweite Bettnachbarin sitzt mittlerweile auf dem Bettrand. Schwarz verhüllt, olivfarbene Haut mit vielen Falten. Sie redet mit mir, ich verstehe nichts. Eine Pflegerin kommt. Die Frau sei aus Nordsyrien, sagt sie, und dass niemand sie verstehe. Sie redet auf die Syrerein ein, die wiederum redet auf Kurdisch auf die Pflegerin ein, die Pflegerin zuckt die Schultern und geht. Die Syrerin kramt ein knisternde H&M-Plastiktüte aus ihrem Rollschränkchen hervor, nimmt riesige Salatblätter und ein dünnes Fladenbrot heraus, wickelt beides zu einer dichten Rolle und reicht es mir. Hungrig bin ich nicht, aber ich esse es, es ist so eine tolle Geste.
Später kommt der Arzt zu mir, der mich betreut. Ein Pneumologe, an den mich meine Kardiologin verwiesen hat. Er setzt sich neben mein Bett. Schlägt die Beine übereinander. Entschuldigt sich zuerst für das Chaos am Vormittag und dass ich jetzt die erste Nacht hier bei den Kurzliegern und unter weniger schönen Bedingungen verbringen muss. Er hört sich meine Geschichte an. Fragt, nickt, notiert alles. Er kennt das Ehlers-Danlos-Syndrom und seine Auswirkungen und Komorbiditäten. Viele davon habe ich mittlerweile. Zu viele. Auch die unmittelbar lebensbedrohlichen. Er erkennt sie – selbst und anhand der Vorbefunde. Das Gespräch macht Hoffnung, dass die Ursache der Atemnot und des massiven Schluckprobleme gefunden wird.
Am frühen Abend kommt ein junger Mann, der sich als Sohn der Syrerin entpuppt und recht gut Deutsch spricht. Ich erfahre, weshalb die Mutter hier ist und dass er noch nie mit einer Schwester oder einem Arzt gesprochen hat. Warum?, frage ich mich. Und erzähle dem Pfleger am Abend, dass der Sohn doch dolmetschen könne. Er hebt die Augenbrauen. „Sohn? Die hat einen Sohn?“ Ich glaube nicht, was ich da höre. In der Nacht weint die Syrerin und weint und weint. So gern würde ich ihr helfen. Doch mir geht es selbst so mies, dass ich froh bin, einfach nur im Bett liegen zu können. Ich habe keinerlei Kraft mehr.
Am nächsten Morgen werde ich auf die Lungenstation verlegt und am Mittag sediert. Bronchoskopie und Magenspiegelung. Eine Männerstimme reißt mich aus dem Narkoseschlaf. Ich öffne die Augen und sehe, ich bin Wiede in meinem Zimmer – in dem direkt neben mir Paul steht. Mein Physiotherapeut. Er arbeitet in dieser Klinik. Eine Mit-EDS-Patientin hat ihm verraten, dass ich hier bin. Angelika schiebt ihren Kopf hinter Pauls breitem Rücken hervor. Die beide lachen. Ein Lichtblick an diesem Tag.
Am Folgetag MRT des Halses und der Ösophagus-Breischlucktest, bei dem man Kontrastmittel trinken muss, während geröntgt wird – was die Speiseröhre und den Übergang in den Magen mittels Röntgenkinematographie wie im Film darstellt und den Schluckakt beurteilt.
Diagnose eins:
Das Bindegewebe im Hals, also in der Luft- und Speiseröhre ist jetzt auch schlaff. Die Muskeln arbeiten zwar gut, doch das Bindegewebe mit den darüber liegenden Schleimhäuten transportiert die Nahrung nicht mehr richtig. Daher bleibt die einfach hängen. Auch das Gefühl, einen nassen Lappen im Hals zu haben, kommt daher. In der Luftröhre ist das Ganze ein sehr großes Problem: Man kann am eigenen, zunehmend schlabbriger werdenden Bindegewebe ersticken.
Diagnose zwei:
Mein Kehlkopf ins hypermobil. Bedeutet: Er lässt sich viel zu weit hin- und herschieben und verdreht sich vermutlich auch in sich selbst. Das drückt bei blöden Kehlkopfstellungen auch die Luftröhre ab. Auch das kann zum Tod führen, wenn es blöd läuft.
Diagnose drei:
Mein Zwerchfell reißt. Wie bei vielen EDS-Patienten. Vor drei Wochen war definitiv noch alles gut, da gab es ja eine MRA und eine CTA. Jetzt schiebt sich der Magen bereits in den Thorax. Der Magen schließt daher auch nicht mehr richtig.
Machen kann man in allen drei Fällen nichts. Was bei EDS so gut wie immer so ist. Woher das Knacken im Kehlkopf kommt und was da genau „hüpft“, konnte nicht festgestellt werden. Auch nicht, was diese schrecklichen Schmerzen im Brustkorb verursacht. Luxierende Rippen sind möglich, Blockaden, die Instabilitäten an sich …
Das alles ist jetzt, wo ich das schreibe, zehn Tage her. In diesen Tagen hat sich mein Zustand massiv verschlechtert. Die Luftnot nimmt zu, ich bin nonstop wie benommen, Der Widerstand im Hals wächst, irgendetwas schiebt sich ständig von links in die Luftröhre. Es ist genau da, wo das Knacken und der Schmerz am schlimmsten ist.
Ein riesiges Problem bilden auch meine instabilen Kopfgelenke. Wer sich damit auskennt, weiß, dass das Symptome an allen Körperstellen bereiten kann, neurologische, vegetative. Denn durch die Kopfgelenke (C0/C1 und C1/C2) laufen alle Verbindungen zwischen Gehirn und Körper. Wenn da etwas eingeklemmt oder auch ständig gereizt wird, hat das fatale Folgen. (LINK). Eng mit den Kiefergelenken verknüpft, die bei mir ja auch ständig Schmerzen und auch luxieren, verliere ich seit einigen Tagen das Richtungshören. Spricht mich jemand an und ich sehe ihn nicht, kann ich nicht sagen, aus welcher Richtung die Stimme kommt. Oder woher sich ein Auto nähert. Die Ohren sind dumpf, als habe jemand mich heftig daraufgeschlagen. Die Geräusche, die ich im „Summen des Teufels“ schon beschrieben habe, nehmen zu. Gleichzeitig bin ich gegen viele Geräusche überempfindlich. Besteckklappern beispielsweise ist wie einen Explosion im Kopf. Je schlechter ich höre, desto vielschichtiger und lauter wir der beidseitige Tinnitus, diese quälende Kakophonie hoher und tiefer Pfeif- und Rauschtöne.
Es sind die Tage …
… an denen ich aufgebe. Ich mag nicht mehr. Das Leben ist dunkel geworden, zieht sich aus jeder Faser meines Körpers zurück. Keine Kraft mehr, keine Hoffnung. Nur Schmerz und Erschöpfung. Ich will mich nicht länger durch jede Stunde quälen, herumlaufen wie ein narkotisierter Zombie, der unter schrecklichste Schmerzen auseinanderfällt. Ich will nicht mehr kämpfen und stark sein. Wozu? Es gibt keine Heilung, keine Besserung, nicht mal mehr Linderung. Es ist kein Leben mehr.
Es sind die Tage …
… an denen ich mich niemandem gegenüber mehr erklären werde. Auch nicht diskutieren. Kein Wenn und Aber mehr. Wer an meiner Erkrankung noch immer zweifelt, trotz Ordner voller Hiobsdiagnosen, wer mir nach jahrelangen Sprüchen, immer da zu sein, wenn ich in Not käme, jetzt die Hilfe versagt, der hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Ebenso, wer sich mal als Freund bezeichnet hat und seit meiner Krankheit leider zig Termine und Geschäftsreisen und Hochzeiten und runde Geburtstage zu absolvieren hat und leider so gar nicht chatten oder gar vorbeikommen kann.
Es sind die Tage …
… in denen ich für meine letzten fünf Katzen gute Hände suchen werde. Es wird dauern, die passenden Menschen mit großem Herzen für diese besonderen Tiere zu finden. Aber das ist mir noch wichtig. Doch dann habe ich keine Verantwortung mehr abzugeben. Dann muss ich nur noch für mich sorgen. Ein paar Tage, Wochen oder Monate lang – wer weiß das schon.