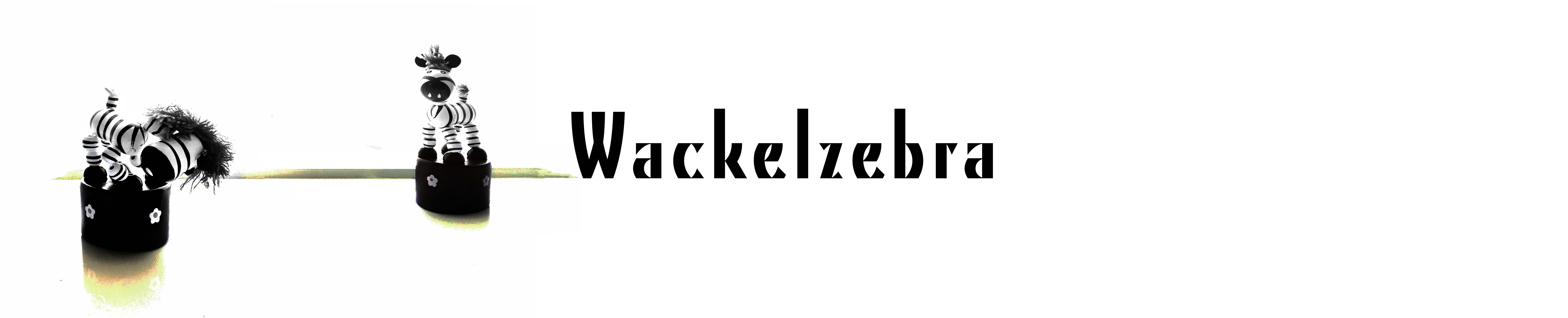Kehle, Lunge, Herz oder was? Eine Nacht auf der Intensivstation
Luftnot. Brustkorb und Brustbein wie in der Presse. Husten. Halsweh. Heiserkeit. Schwindel. Herzrasen. Nahrung, die in der Speiseröhre einfach stecken bleibt. Beim Drehen des Oberkörpers knirscht alles. Der Kehlkopf knackt und springt beim Schlucken. Kopf leicht wenden geht nur gegen Widerstand. Meine Blutwerte rutschen seit Monaten in eine Anämie ab. Ursache unklar. Am Montagmittag war das alles dann so schlimm und die Luftnot so groß, dass ich kurz vor der Ohnmacht eine Freundin angerufen habe. 40 Minuten später war ich in der Klinik. Verdacht: Lungenembolie.
16 Uhr. Ich liege im Schockraum. Japsend, mit üblen Schmerzen und natürlich auch mit Angst. Luftnot ist echt etwas ganz Böses. Ein Pfleger legt den Venenzugang (oh Wunder: Der Arm wird nicht sofort dick und blau) und zapft gleich gefühlte drei Liter Blut, während der Arzt mich abhört und befragt. „Symptomatisch“, sagt er, „sieht es aus wie Lungenembolie oder Herz.“ Ich sage, dass ich Ehlers-Danlos-Patientin bin, und er antwortet, das habe er im Studium schon mal gehört. „Gendefekt, oder? Bindegewebe?“ Ich nicke. Er hängt mich an eine Infusion. Ich mustere seine grauen zerzausten Haare und den ebenso grauen Schnurrbart. Die runde Brille. Das runde Gesicht. An dem Mann ist alles rundlich, sogar die Stimme klingt warm und rund. Er wirkt sympathisch. Sein Studium muss gut dreißig Jahre zurückliegen. Aber egal. Er soll jetzt das mit der eventuellen Lungenembolie klären.
16 Uhr 50. Ich war beim Thorax-Röntgen. Und die Butwerte sind fertig. Die D-Dimer sind normal. Heißt: keine Thrombose, keine Blutgerinnsel, die in die Lunge gewandert sind, ergo keine Lungenembolie. Troponin in der Norm. Also auch kein Infarkt. Aber als jetzt, weil auf die Schnelle nichts zu finden, der Klassiker kommt – „Das sind wohl nur die dreißig Grad draußen und Ihre Psyche, so kommt zur Zeit jeder zweite Patient hier an“ – bin ich raus aus der Sympathienummer. „So einfach ist es bei mir leider nicht“, krächze ich. Meine Stimme wird immer übler. Er sieht mich an und überfliegt meine Vorbefunde. Ganz sicher scheint er sich seiner harmlosen Diagnose dann selbst nicht mehr zu sein. „Sie bleiben lieber da“, entscheidet er. „Wir legen Sie erst mal auf die Vier. Das ist intensiv.“
Ein Pfleger schiebt mich im Bett durch Gänge, in einen Aufzug, wir fahren in den Keller, es rumpelt, raus aus dem Aufzug und rein in einen düsteren Kanal, der einer wackligen Gangway gleicht. Das Bett poltert gegen eine alte Tür, auf der ein offenbar selbst ausgedrucktes Schild Intensivstation klebt. Schummriges gelbes Licht. Irgendwo schreit jemand pausenlos. Eine junge weibliche Stimme redet auf den Schreihals ein. Ich frage mich, ob ich im vorletzten Jahrhundert gelandet bin.
Gegen 18 Uhr liege ich verkabelt zwischen Blubber- und Piepsgeräuschen, von meiner stöhnenden Zimmernachbarin nur durch einen mintgrünen Vorhang getrennt. Auch die Wände sind mintgrün getüncht. Warum eigentlich sind Intensivstationen immer in diesem Pastellton gehalten, der an ausgekotzte Zahnpasta erinnert?
Es ist stickig. In einem andern Zimmer brüllt der Schreihals. Hinter meinem Kopf der Monitor, auf dem Herz und Kreislauf bunte Linien und Zacken schreiben, daneben ein olivgrüner Perfusor mit braunen Flecken, zwei Infusomaten und die üblichen Anschlüsse für Sauerstoff & Co.
Und dann … passiert nichts mehr. Ich liege und liege, versuche zu schlafen. Vergebens. Um kurz vor 22 Uhr steht plötzlich eine junge Ärztin mit fahrbarem Ultraschallgerät neben mir. In – ich sag mal „ambitionierten“ – sechs Minuten schallt sie meine gesamten Bauchorgane, telefoniert nebenher, und meint dann, es sei alles gut. Ich frage ganz unschuldig, ob auch die linke Niere okay sei? Ihr Notruf piepst, sie rennt weg, mir geht die Diagnose der Gefäßkompressionen durch den Kopf samt der so gut wie nicht mehr durchbluteten, angeschwollenen Niere. Irgendwann ist die Ärztin wieder da. „Was wollten Sie jetzt wissen wegen der Niere?“ „Ob die okay ist mit der Größe und Durchblutung.“ Sie fragt nicht, warum ich das wissen will. Setzt nur den Schallkopf noch einmal auf und misst. Zieht die Augenbrauen hoch. „Sie haben recht. Ziemlich groß.“ „Und die Burchblutung?“, frage ich. „Das sehe ich ohne Farbdoppler nicht“, antwortet sie und rollt das Ultraschallgerät vor sich her zur Tür hinaus. Gute Nacht.
Kein Farbdoppler auf der Intensiv. Eine Ärztin, die die riesige Niere nicht sieht. Mein Vertrauen schwindet mit jeder Minute, in der ich zum Schreien des Schreihalses die verschrammten Geräte über meinem Kopf und die dunkelbraune Türdichtung betrachte, die lose oben aus dem Türrahmen baumelt. Vorletztes Jahrhundert könnte hinkommen. Oder eine dieser Horror-Fernsehserien aus der Rechtsmedizin.
Irgendwann schlafe ich dann doch ein. Bis mich wieder jemand anstupst. „Wir brauchen noch mal Blut. Wir sollen Troponin kontrollieren.“ „D-Dimere sollten noch einmal kontrolliert werden“, wende ich ein. Der junge Mann verschwindet, kommt gleich darauf mit einer Akte in der Hand zurück. „Stimmt. Dann machen wir jetzt halt beides noch mal.“ Ich halte ihm den Arm mit dem Venenzugang hin. „Nein, andere Seite, wo es frisch ist.“ „Frisch?“ „Ja, wo Sie keine Infusion bekommen haben.“ Ich schaue auf die Uhr. Kurz vor Mitternacht. „Die ist fast acht Stunden her.“ „Hm, ja, aber zur Sicherheit …“ Und schon steckt eine Kanüle im anderen Arm. Dieses Mal tut’s wieder mega weh, wie üblich bei mir. Aber es ist schnell geschafft. Und natürlich dick und blau. Unterm Venenzugang dagegen sieht seltsamerweise noch immer alles normal aus.
Am nächsten Morgen stehen Punkt acht Uhr sechs Ärzte und fünf Pfleger um mein Bett. Einer stellt sich als Chefarzt vor und fragt, ob ich auch die Gelenke „so lustig verbiegen“ kann. Er hat Glück, dass ich noch müde bin. „Ja, kann ich, aber lustig ist es nicht“, flüstere ich. „Und ich demonstriere auch nichts, denn das tut extrem weh.“ „Hm, schade, na dann. Sonst alles okay? Blut von heute Nacht ist ganz normal.“ Wieder einer von denen, der EDS für einen Zirkusnummer hält. „Nein, es ist nicht alles okay“. Ich erkläre, dass ich noch immer Luftnot und immer wieder Herzrasen habe, mir schwindelig ist und mein Brustkorb und das Brustbein sich anfühlen wie in der Presse. Und dass das Blutbild beim Ehlers-Danlos-Syndrom meist normal aussieht, wenn nicht gerade spezielle Komplikationen auftreten. Er nickt, weist jemanden an, das aufzuschreiben. Dann verschwindet die Männer-Mannschaft hinterm mintgrünen Vorhang bei meiner Zimmernachbarin. Ein junger Kerl bleibt etwas abseits der anderen stehen und grinst zu mir herüber.
Als sie weg sind, stellt mir die Schwester einen Kaffee und ein Brötchen mit zwei Scheiben Wurst auf den Nachttisch. Ich sage ihr, dass ich wegen Histamin keinen Kaffee trinken möchte und außerdem kein Fleisch esse. Sie schaut auf den Aufnahmebogen. „Da steht aber: ‚Wenn möglich vegan’.“ Ich starre sie an. Sie fährt fort: „Von vegetarisch steht nichts da.“ Ich hole kurz Luft so gut es geht und erkläre ihr, was vegan ist. Dass es aber okay sei, wenn sie mir einfach einen Tee und statt der Wurst eine Scheibe Käse bringen würde. „Ja gern“, sagt sie, lächelt und holt Käse und Tee. Dann plaudern wir ein wenig. Sie fragt viel über EDS, ist interessiert und auch frustriert, „weil wir Ihnen nicht helfen können.“
Um 9 Uhr steht der junge Kerl, der mich vorhin angegrinst hat, an meinem Bett. „Sie kommen auf die Zwei.“ „Ah, was ist den die Zwei?“ „Station.“ „Schon, aber welche?“ „Innere. Wir machen ein Herzecho.“ Ich fühle mich plötzlich an den 10. Dezember und die „drei Tage und kein Herzinfarkt“ erinnert. Aber ich bin ja vorgewarnt und werde sicher nicht tagelang hier liegen und mir anhören, dass ich froh sein könne, weil ich keinen Herzinfarkt habe. Dass ich den nicht habe, weiß ich auch so.
Der Herzschall ist dann rasch gemacht – und zwar von dem Arzt, der mich gestern aufgenommen hat. Ich warte auf die „Wetter-und-Psyche“-Nummer. Sie kommt nicht. Statt dessen stellt er den (mir bekannten) Mitralklappenprolaps fest. „Das passt natürlich gut zu Ihrem EDS.“ Ich schaue ihn an. Er lacht und fährt fort: „Genauso wie die Atemnot dazu passt, aber die kann viele Ursachen haben in dem Zusammenhang. Wirbelblockaden oder -verschiebungen kommen in Frage oder auch ein funktionelles Problem im Kehlkopf. Vielleicht ist es auch ein Stimmritzenkrampf oder die Vorstufe dazu. Oder etwas anderes.“
Er hat sich eingelesen über Nacht. Ich bin überrascht. Positiv überrascht. „Zumindest haben Sie keine Lungenembolie und derzeit auch keine lebensbedrohliche Komplikation. Sie können dann nach Hause gehen.“ Meine Frage, ob nicht in der Klinik noch eine Kehlkopfspiegelung gemacht werden könne und auch die Gastroskopie, die er angeraten hatte, verneint er. Keine HNO-Abteilung im Haus und in der Gastroenterologie Personalmangel. Ich soll alles Weitere ambulant klären. Das ist frustrierend. Für einen weiteren Ärztemarathon fehlen mit Kraft und Lust.
Ich gehe zurück ins Zimmer. Packe Handtuch und Zahnbürste ein, die ich vor dem Herzecho erst ins Bad gelegt hatte. Den Venenzugang muss ich mal wieder selbst ziehen, nachdem ich dreimal vergeblich gebeten habe, dass es vom Fachpersonal gemacht wird. Aber wer seinen Katzen Infusionen legen und ihnen spritzen geben kann, ist mit dem Entfernen eines Viggo wohl kaum überfordert.
Die Freundin, die mich auch hergebracht hat, holt mich ab. Zu Hause schmusen die Katzen um mich herum. Körperlich besser geht es mir nicht.
Und was hab ich jetzt von diesem Kurzaufenthalt in der Klinik?
Die Sicherheit, dass ich keine Lungenembolie habe. Das Wissen, dass meine Anämie zum ersten Mal seit einem halben Jahr zurückgegangen ist. Eine Krankenschwester, die nun etwas über das Ehlers-Danlos-Syndrom weiß. Und einen Krankenhausdoc, der sich aus eigenen Stücken darüber schlau gemacht hat. Möge es einem EDS-Patienten, der nach mir zu ihm kommt, helfen. Und der Doc es weitertragen.