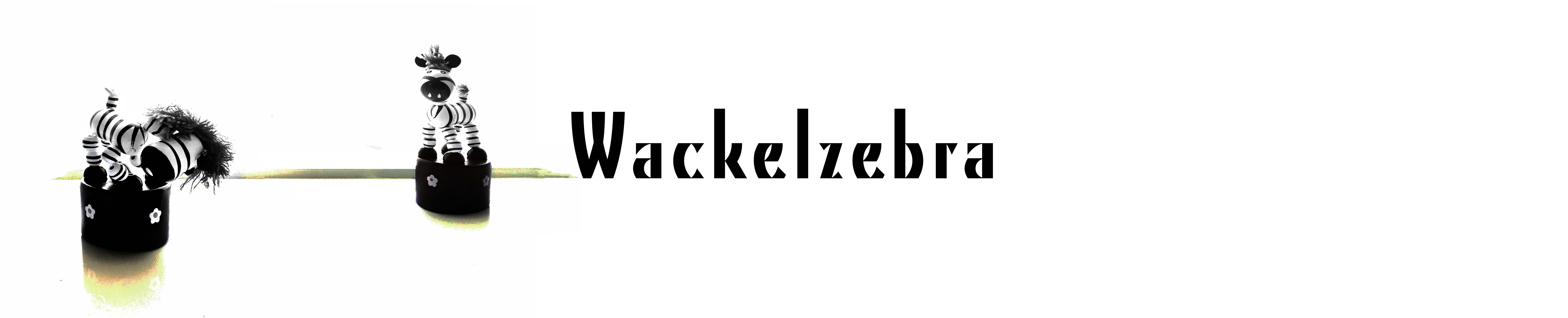Drei Tage (kein) Herzinfarkt oder: in der Schrottpresse
Der Winter ist hart. Tagein, tagaus nichts als Gelenkschmerzen, Muskelzittern, Krämpfe aus der Hölle, Schwindelanfälle, Sehstörungen, extreme Luftnot, Herzrasen vom Feinsten auch in Ruhe, jeder Schritt ein qualvolles Wackeln und gleichzeitig ein Lichtblick, weil ich es schaffe, von der Waagrechten in die Senkrecht zu kommen und mich vier Meter in die Küche zu schleppen. Ein Tee, ein Kaffe und die Katzen füttern – daraus besteht momentan mein Leben. Und aus Arztpraxen, Notaufnahmen und Kliniken.
Am späten Nachmittag des 10. Dezembers verstärkt sich meine Luftnot akut. Jede Bewegung ist, als stecke ich in einer Schrottpresse. Und so fühle ich mich auch. Stahlwände, die meinen Müllkörper vollends in die Tonne kloppen. Ich rufe eine Freundin an. Sie kommt sofort. Alarmiert den Notarzt. Ich erkläre die Lage.Im Rettungswagen vor dem Haus fragt der mich, in welche Klinik ich möchte. Er nennt mir drei Alternativen. Ich nehme die, die auf Wirbelsäule spezialisiert ist. Der Arzt schließt mich an irgendwelche Schläuche an, spritzt mir was, steigt aus. Dann ruckelt und schwankt es, es riecht nach Kunststoff und Chemiereiniger, mein Blick geht von der weißen Wagendecke zu den matten Scheiben und zu dem Rettungssanitäter mit dem riesigen Schnauzbart, der auf mich einredet, dem ich aber nicht zuhöre. Ich will tot sein. Aber meine Katzen brauchen mich.
Eine weitere Stunde später liege ich in der Notaufnahme des Klinikkomplexes. Weiße Vorhänge um mich, am Mittelfinger das Oxymeter, im Handrücken der schon jetzt schmerzende Venenzugang, schräg über mir der Monitor mit den flimmernden Linien und Zacken. Selbes Spiel wie am 30. Oktober und am 6. November – akute Atemnot, Schmerzen zum Sterben. Nur eine andere Klinik.
Dieses Mal behalten sie mich da. Nachdem mal wieder geklärt ist, dass ich keinen Herzinfarkt habe – EKG, Herzecho, Röntgen – legen sie mich auf die Innere. Ich protestiere, so gut ich das noch irgendwie kann. Offenbar nicht gut genug. Noch während sie mich im Bett zu einer laut atmenden alten Dame ins Zimmer schieben, erkläre ich zum zigten Mal, dass die Luftnot von der blockierten Wirbelsäule und kommt und ich in die Orthopädie wollte. Dass ich außerdem keinen bleibenden Venenzugang bekommen darf, weil die durch die Bindegewebserkrankung die Plastiknadel sofort innen an der Gefäßwand anliegt. Dass das höllisch weg tut und wie er sehen könne schon jetzt alles blau ist. „Ja, ja, Sie bekommen jetzt erst mal was zur Beruhigung“. Ich ahne nichts Gutes. Der Venenzugang bleibt. Weil das „so üblich“ ist. In der Nacht ziehe ich mir das Ding selbst. Darin hab ich mittlerweile Übung. Es ist einen kleine Erlösung.
11. Dezember: EKG, Herzecho, Röntgen zum Zweiten. Ohne Befund bis auf den bekannten Mitralklappenprolaps. Ach. Ratlose Gesichter. Aber der Kardiologe ist überzeugt, dass da was mit dem Herzen ist. Ich widerspreche. Bin kardiologisch vor erst zwei Wochen komplett gecheckt. Bitte um ein orthopädisches Konsilium. “Sie sind hier in der Inneren. Da ist nichts zu machen.“ Dann regt er sich über den fehlenden Venenzugang auf. Ich schließe die Augen und versuche zu atmen. Die Dame neben mir beginnt laut zu röcheln. Später rasselt die Lunge. Ich bin ausgebildete Hospizhelferin. Weiß, was das bedeutet. Die Schwester stellt einen Paravent zwischen ihr und mein Bett. Am Abend ist sie tot. Ich bin allein im Zimmer. Die Schrottpresse drückt weiter zu.
Gegen 23 Uhr kann ich nicht mehr. Drücke den roten Knopf, der vom Galgen über mir baumelt. Die Schwester findet mich nach Luft schnappend im Bett. Piept den Arzt an. Sie spritzen mir irgendwas. Es hilft nicht. Der Arzt ist irritiert. Ich nicht. Ich weise ihn auf die Blockade hin. Er lächelt und sagt, ich sei auf der Inneren. Also würde ich auch entsprechend therapiert.
Gegen halb zwei Uhr poltert ein Pfleger herein. Mein Zimmer wird für einen Mann gebraucht. Er reißt meine Sachen aus dem Schrank, knallt sie aufs Fußende meines Bettes und schiebt mich durch spärlich beleuchtete Flure in ein anderes Zimmer. Die beiden Frauen dort wachen auf und motzen. Es riecht nach Schweiß und Nacht. Ich sage, dass ich Schmerzen habe und nicht mehr schlafen kann. Er kommt mit einer Spritze. Morphin. Ich sage ihm, dass das bei mir nicht wirkt. Er zieht einen Mundwinkel hoch und haut mir die Spritze in den Arm. Ich liege bis zum Morgen wach und versuche, die Stahlwände der Schrottpresse aufzuhalten, die sich unerbittlich um mich schließen.
12. Dezember: Zum Frühstück gibt’s Morphin und ein weißes Brötchen. Der Urinbeutel meiner Bettnachbarin tröpfelt vor sich hin. Danach kommt der Kardiologe. Es soll ein EKG gemacht werden. Plus Herzecho. Und röntgen. Ich stöhne auf und erkläre zum rund zwanzigsten Mal, dass ich keinen Herzinfarkt habe, auch nicht nach fünfzig EKGs und Echos, und dass ich bitte bitte einen Orthopäden sehen will. Dass ich eine schwere BWS-Blockade habe. Wegen des Ehlers-Danlos-Syndroms. Der Kardiologe lächelt. „Kenne ich nicht.“ Er nickt einer der drei Schwestern zu, die er im Schlepptau hat. Sie hält die Spritze schon parat. Tritt auf mich zu. Ich frage, was das werden soll. „Tavor.“
Sie Situation erinnert mich an einen dieser ganz schlechten Krimis. So ein Trash-Ding, in dem ein gesunder Mensch in Folge fieser Machenschaften in der Psychiatrie landet und gegen seinen Willen zwangsbehandelt wird und jeder weiß, dass er unschuldig ist, nur nicht der völlig vertrottelte Ermittler.
Ne, das will ich nicht.
Ich ignoriere Schrottpresse, Schmerz und Scham, setze mich auf und brülle in die Runde. „Verdammte Scheiße, hört mir hier eigentlich irgendwann mal irgendjemand zu!? Ich habe das Ehlers-Danlos-Syndrom und keinen Herzinfarkt und brauche auch keine Tranquilizer. Ich brauche einen Orthopäden. Und wenn Sie das Ehlers-Danlos-Syndrom nicht kennen, aber eine Patientin damit hier haben, dann müssen Sie sich verdammt noch mal die Mühe mache, wenigsten danach zu googeln, bevor Sie mich tagelang falsch behandeln.“ Das Lächeln auf dem Gesicht des Kardiologen erstirbt. Die Schwester lässt den Arm mit der Spritze sinken. Totenstille im Zimmer. Der Kardiologe geht wortlos hinaus. Eine Schwester flüstert schließlich ein „Tut mir leid“ und verlässt mit den andern das Zimmer. Meine Bettnachbarinnen brüten über einem Sudoku.
Kurz darauf steht eine junge Ärztin neben meinem Bett. Auch sie kann kaum Deutsch. Sie verspricht, dass „eine gutte Dottor von Wirrrbelsäule“ bei mir vorbeischaut. Spätestens in einer Stunde.
Drei Stunden später liege ich noch immer in der Schrottpresse und warte. Auf den finalen Schub oder den gutte Dottor. Keiner von beiden kommt. Dafür die junge Ärztin. Es tue ihr leid, aber die Dottor … Konferenz, Notfall, Zeit knapp und ich müsse verstehen … Ja, ich verstehe. Und ich bin ganz ruhig. Bitte sie, bis 15 Uhr meine Entlassungspapiere fertigzumachen. Sie hebt die Augenbrauen, radebrecht mich zu von wegen „Rissiko mit die Herz“ und anderen Schreckensszenarien. Ich quäle mich aus dem Bett und zerre die Reisetasche aus dem Schrank. Sie geht. Kurz bevor ich in den Flur und Richtung Ausgang hinauswackle, kommt eine Schwester zu mir und drückt mir verlegen ein Fentanylplaster auf die Schulter. „Vielleicht hilft es ja doch, Sie sollen doch nicht leiden. Alles, alles Gute für Sie.“
Um 16 Uhr sitze ich einem niedergelassenen Orthopäden gegenüber. Ich kenne ihn nicht. Aber er kennt das Ehlers-Danlos-Syndrom. Über eine EDS-Facebook-Gruppe bin ich zu ihm gekommen. Vier Griffe von ihm, ein verhaltener Schmerzensschrei von mir – die Blockade ist gelöst. Schrottpresse ade.
Einige Tage später fülle ich den Patientenzufriedenheitsbogen des Klinikträgers aus. Der lag praktischerweise den Entlassungspapieren bei. Mit (genutzter) Ankreuzmöglichkeit, „Ich wünsche ein Gespräch mit dem Klinikträger.“ Bis heute gibt es keine Reaktion. Und ich weiß: Es wird nie eine kommen.