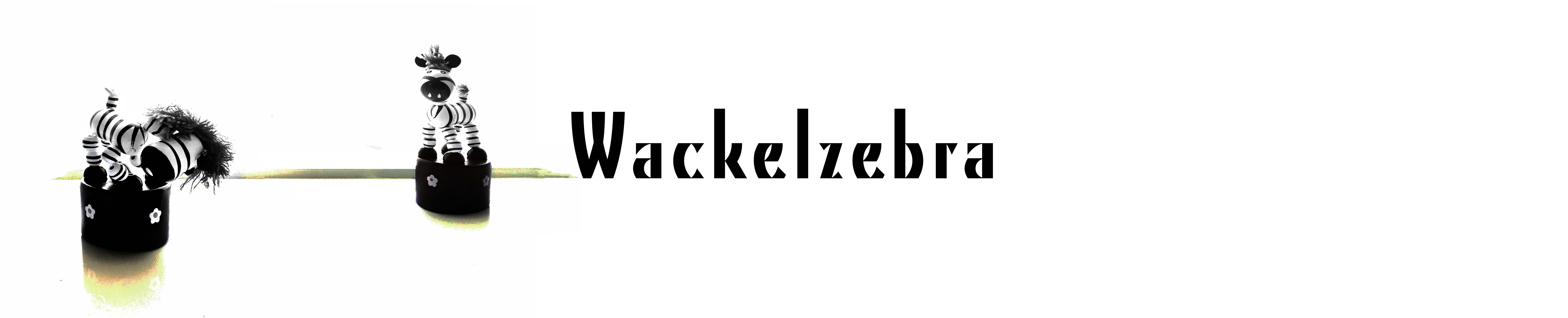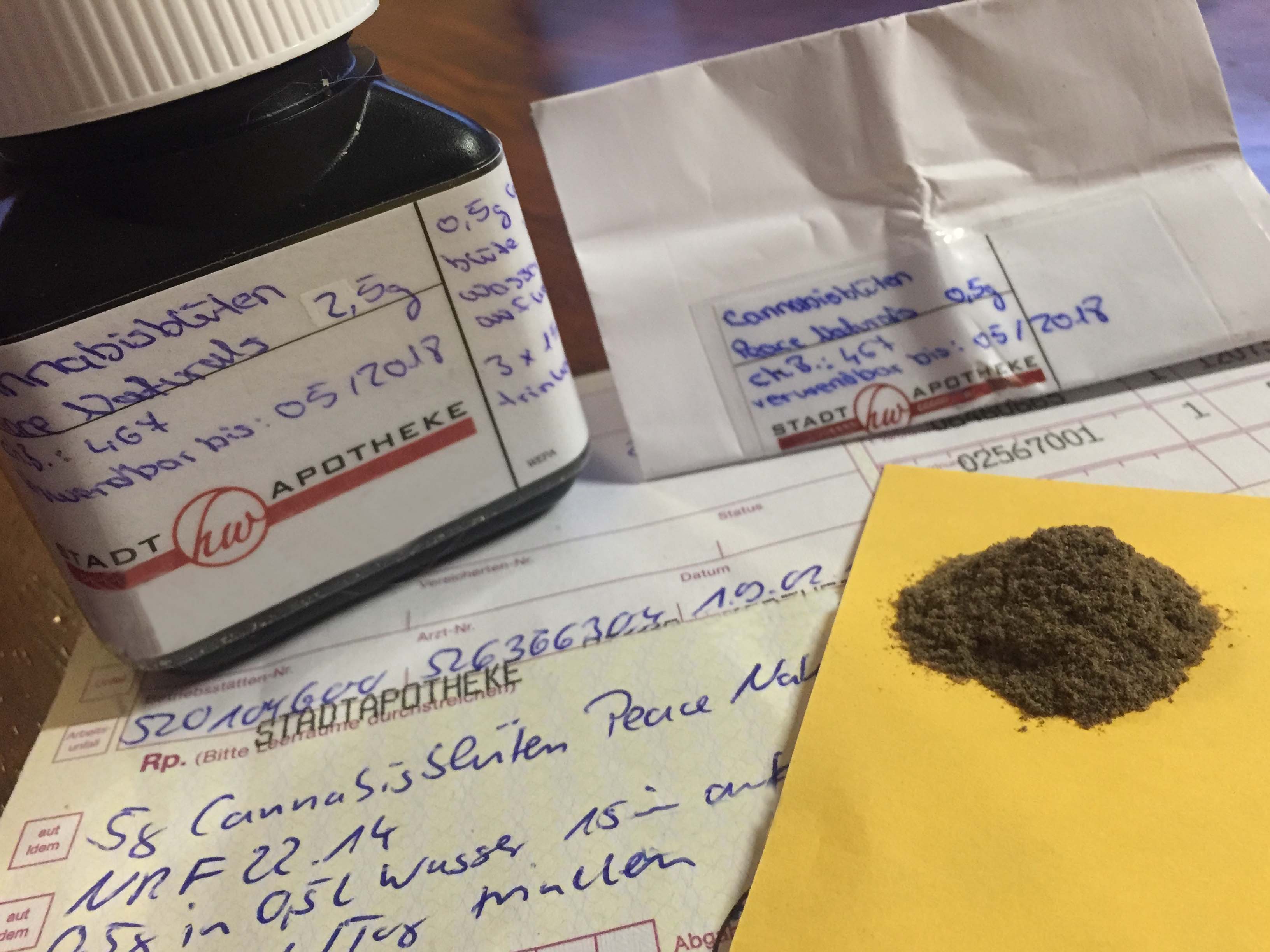Mein erster Cannabisblütentee. Oder: der schlechteste Trip meines Lebens
Ibu, Diclo, Tilidin & Co. sind durch. Nichts wirkt so recht bei mir. NSARs helfen gar nicht, Opiate dämpfen die quälenden Schmerzen mit etwas Glück. Doch das Bisschen weniger an Gelenk-, Muskel- und reißenden Organschmerzen bezahle ich dann mit Bauchkrämpfen und noch mehr Müdigkeit. Mein neuer Schmerztherapeut hat da nicht lang gefackelt – und mir medizinisches Cannabis auf Privatrezept verschrieben.
Zum Testen sollte es sein. Wenn’s hilft, werden wir bei meiner Krankenkasse einen Antrag auf künftige Kostenübernahme stellen. Denn preiswert ist das Zeug gerade nicht. 123,40 Euro hab ich für fünf Gramm bezahlt. Das sind zehn Tagesdosen. Und die sollte ich als Tee süffeln. Doch bis es soweit war, musste ich noch ein paar Wochen warten. Denn nirgends waren Cannabisblüten lieferbar. Nachfrage zu groß. Dann endlich war wieder „Stoff“ zu haben. Aber keine Apotheke zu finden, die es besorgt.
Drei Tage hing ich am Telefon. Erklärte rund 70 Apothekern, wie, was und warum. Und dann endlich hielt ich sie in Händen: zwei kleine schwarze Plastikdöschen, darin je fünf Tagesdosen zu 0,5 Gramm fein granulierter Blüten. Täglich den Inhalt eines Päckchens in einem halben Liter Wasser für 15 Minuten kochen und davon drei Mal je 150 ml trinken. So die Anweisung des Arztes.
Gesagt, getan, getrunken.
Das war gestern um 12 Uhr 30. Mein erster Gedanke beim ersten Schluck: igitt! Aber es ist ja Medizin. Und irgendwie erinnerte mich der süßliche Dampf aus dem Topf an Studienzeiten und so manch nächtliche Feier, bei denen der eine oder andere Joint durch die schummrig erleuchtete Aula kreiste. Ein paar bunte Bilder, ein angenehmes Drehen im Kopf, mit dem Fahrrad durch die frühmorgendliche Stadt nach Hause – das war’s. Harmlos. Nichts gegen das, was nun, ein Vierzel Jahrhundert später, folgen sollte.
30 Minuten vergingen. Meine rechtes Knie fühlte sich besser an, die linke Schulter ließ sich ohne laut zu stöhnen bewegen, und der Rücken stand nicht mehr in Flammen, sondern glühte nur noch. Vorsichtiges Hoffen. Nach einer Stunde spürte ich ein leichtes Schwindelgefühl. Angenehm. So leicht. Wolkig. Sonnengelb. Fast wie ein Lächeln. Nach 90 Minuten verdichteten sich die Wolken. Schoben sich vor das Sonnengelb. Das Lächeln wurde zum Grinsen. Und dann schnitt es eine Grimasse. Ich kippte auf dem Küchenstuhl nach vorn und knallte auf den Tisch. Irgendwie habe ich es noch vom Küchenstuhl aufs Sofa geschafft.
Und plötzlich war alles lila, grün und golden: Dreiecke tanzten um mich, blinkende Kreise mischten sich dazu, ich hörte schrille Musik und roch verglühende Wunderkerzen, die Dreiecke wuchsen und wuchsen, holten Quadrate und Kegel in ihre Runde und mischten sich zu einem glitzernden Kaleidoskop, so schön und leuchtend, wie ich es nie gesehen hatte. Ich war happy. Wollte mehr. Wollte singen und tanzen und mit den Dreiecken jonglieren, wünschte, dass diese Halluzinationen nie wieder aufhören. Doch puff – noch während dieses Gedankens waren sie auch schon weg.
Geschwitzt, geschwankt, gekreiselt.
Die nächsten fünf Stunden lag ich auf dem Rücken auf dem Sofa, hatte Bauchkrämpfe, musste dringend pinkeln und spürte, wie mir der Schweiß aus allen Poren drang. Ich wollte ins Bad, erbrechen und auf die Toilette. Mir kaltes Wasser ins Gesicht spritzen. Doch sobald ich die Augen auch nur einen Millimeter öffnete, raste die Zimmerdecke auf mich herab. Ich versuchte, ein Bein auf den Boden zu bringen. Steh auf!, sagte ich mir. Doch das Bein bewegte sich nicht. Los! Nichts. Nur mein Magen rührte sich, und ich glaubte, ein Schaufelbagger durchwühle meine Eingeweide.
Irgendwann später, sehr viel später, konnte ich die Augen öffnen. Um mich war es dunkel. Ich tastete nach meinem iPhone. Rutschte mit dem Finger mehrmals vom Display ab, bis ich endlich die Home-Taste drücken konnte und die grelle Zeitanzeige mich blendete. 18 Uhr 55. Draußen war längst die Sonne untergegangen, in den schwarzen Nachbarhäusern zeichneten die Fenster sich wie erleuchtete Rechtecke ab. Mühsam setzte ich mich auf. Verharrte kurz, bis mein verheerender Blutdruck halbwegs in die Gänge kam. Ins Bad brauchte ich gefühlte zehn Minuten. Vermutlich sind es nur 20 Sekunden gewesen.
Kurz vor 22 Uhr war ich wieder ansprechbar, hörte und sah Marietta Slomka über Trump, US-Waffengesetze und Dieselfahrverbote reden, doch in meinem Gehirn kamen die News noch nicht so recht an. Immerhin: Ich hatte geduscht, die verschwitzte gegen frische Kleidung getauscht und 40 Tropfen Novalminsulfon 500 eingeworfen. Denn die Schmerzen waren mit Vehemenz zurückgekehrt, sobald ich aufgestanden war.
Auf dem Herd stand der Topf mit den restlichen 300 Millilitern Cannabisblütentee. Ration zwei und drei für diesen Tag. Getrunken habe ich nichts mehr davon.
Und so heißt es nun: beim nächsten Mal mit einem Schnapsglas statt halben Teebecher starten. Zwei Stunden warten, dann ein weiteres Schnapsglas voll trinken. Und mich vorsichtig an die passende Dosis herantasten. Prosit!